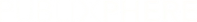Gewalt 2.0 (erschienen in Psychologie Heute)

von Anke Römer
Kinder und Jugendliche verbringen einen erheblichen Teil ihrer Freizeit in virtuellen Welten. Sie unterhalten sich in Chatrooms, pflegen Kontakte auf Netzwerkplattformen und schicken sich Nachrichten über Dienste wie Skype. Doch im Cyberspace werden nicht nur Nettigkeiten ausgetauscht. Im Gegenteil: Die Gewalt im virtuellen Raum nimmt immer mehr zu.
Hinweis: Dieser Text erschien erstmals im September 2010 im Magazin "Psychologie Heute". Die Redaktion von "Psychologie Heute" hat ihn Publixphere im Rahmen des Schwerpunkts Aggressionen im Netz freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Megan war verliebt. Ihr Verehrer Josh, 16, sah gut aus und zeigte großes Interesse an ihr. Kennengelernt hatte sie ihn auf der Internetplattform MySpace. Seither machte er ihr über das Internet Avancen. Megan betete ihn an. Doch plötzlich wollte er nichts mehr von ihr wissen, beleidigte und demütigte sie. Megan wird nie erfahren, warum die 13-Jährige hat sich noch am Abend ihrer Verschmähung erhängt. Die Wahrheit ist: Hinter der virtuellen Figur des Josh steckten eine ehemalige Freundin und deren Mutter, die sich an Megan rächen wollten.
Das Drama spielte sich im Jahr 2006 in den USA ab. Seither sind weitere Fälle aus Großbritannien, Kanada und Australien bekannt geworden, in denen sich Jugendliche das Leben genommen haben, nachdem sie im Internet schikaniert, bloßgestellt oder bedroht wurden. Cybermobbing oder Cyberbullying (bei Kindern) nennt man das Phänomen, bei dem Menschen moderne Kommunikationsmittel wie Internet und Handy dazu benutzen, anderen zu schaden. Die Palette reicht dabei vom Verbreiten peinlicher oder manipulierter Bilder über rüdes Beschimpfen, das Verbreiten von Lügen bis hin zur Morddrohung. Einer Studie der Universität Landau aus dem Jahr 2009 zufolge wurde jeder siebte Jugendliche in Deutschland bereits Opfer von Cyberbullying, insgesamt rund zwei Millionen Schülerinnen und Schüler. In einer Umfrage der Universität Münster lag die Zahl sogar bei über einem Drittel der befragten jungen Leute.
Vermutlich werden die Zahlen in Zukunft steigen. Denn der Medienkonsum nimmt immer mehr zu, wie die KIM-Studie (Kinder und Medien, Computer und Internet) des Medienpädagogischen Forschungsverbandes Südwest aus dem Jahr 2008 zeigt. Inzwischen gibt es in etwa 90 Prozent aller Haushalte einen Computer mit Internetzugang. Und der wird rege genutzt ab zwölf Jahren von den meisten täglich. Mit zarten acht Jahren machen Kinder im Schnitt ihre ersten Erfahrungen mit dem Internet.
Das Plaudern in sogenannten Chatrooms ist zu einer der wichtigsten Kommunikationsformen für Kinder und Jugendliche geworden. Unter einem Chatroom versteht man eine Internetseite, auf der sich Nutzer in Echtzeit über Textnachrichten miteinander unterhalten können. Im Jahr 2005 befragte die Expertin für Cyberpsychologie Catarina Katzer gemeinsam mit Forschern von der Universität Köln 1700 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 11 zum Thema Cyberbullying am Beispiel von Chatrooms. 69 Prozent der Befragten unterhielten sich regelmäßig in solchen Plauderräumen, davon fast ein Drittel täglich oder mehrmals täglich. An Schultagen wurde durchschnittlich 70 Minuten gechattet, an Tagen ohne Unterricht 122 Minuten. Die erste Chaterfahrung machten Kinder im Schnitt mit 11,9 Jahren, und 20 Prozent waren bei ihrem ersten Chatbesuch sogar nur zehn Jahre oder jünger.
Parallelen zwischen Schulhof und Cyberspace
Die vielfältigen Kontakte im Cyberspace haben auch ihre Schattenseiten: Jetzt wird nicht nur im Klassenzimmer, auf dem Schulhof oder dem Schulweg gehänselt und gedroht, sondern auch in der virtuellen Welt des Internets. 44 Prozent der Jugendlichen in Katers Studie gaben an, bei ihrer Chatunterhaltung regelmäßig gestört zu werden. Viele wurden beleidigt oder beschimpft (39 Prozent), geärgert (35 Prozent) oder in Streit verwickelt (32 Prozent). Zehn Prozent wurden ausgegrenzt, acht Prozent massiv bedroht und 17 Prozent mit übler Nachrede überzogen.
In ihrer Studie haben Katzer und ihre Kollegen auch untersucht, wer zum Täter und wer zum Opfer von Cyberbullying wird. Es zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zum klassischen Bullying in der Schule: Wer Täter war, war dies häufig sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt. Von den Jugendlichen, die in der Schule als Aggressor agierten, zeigten 79 Prozent auch in Chatrooms Bullyingverhalten. Und 63 Prozent der in der Schule gemobbten Jugendlichen wurden auch im Internet zum Opfer.
Doch warum wird der eine zum Täter und der andere zum Opfer? Was sind die Risikofaktoren? Dieser Frage ist Catarina Katzer gemeinsam mit Detlef Fetchenhauer von der Universität Köln in einer weiteren Studie im Jahr 2007 nachgegangen. Demnach betrifft Cyberbullying wie die Gewalt in der Schule hauptsächlich Jungen. Sowohl die Täter als auch die Opfer sind häufiger Jungen als Mädchen. Viele Täter hatten eine problematische Beziehung zu ihren Eltern. Die Cyberbullies zeigten nicht nur im Netz, sondern auch in der Schule und in der Freizeit ein aggressives, dissoziales und delinquentes Verhalten. Sie besuchten häufig Prügel-, Rechtsradikalen- oder Pornochatrooms, logen gezielt bei Chatbesuchen, schwänzten regelmäßig die Schule und fielen durch Ladendiebstähle und Sachbeschädigung auf.
Auch bei den Opfern zeichneten sich deutliche Parallelen zwischen Schulhof und Cyberspace ab. Die Betroffenen waren meist unbeliebte Außenseiter; sie waren eher introvertiert, sensibel, ängstlich, vorsichtig und wenig selbstbewusst. Wie die Täter hatten die meisten eine problematische Beziehung zu ihren Eltern. Die Opfer wuchsen größtenteils in einem stark überbehütenden Elternhaus auf. Vielleicht als Trotzreaktion darauf besuchten sie häufig Websites, die zu Aggression und Gewalt geradezu auffordern nämlich dieselben Prügel-, Rechtsradikalen- oder Pornochatrooms, die die Täter gerne nutzten. Auch die Opfer verbargen dabei oft ihre wahre Identität, gaben Alter oder Geschlecht falsch an und logen gezielt im Chat.
Sich älter, schöner oder stärker zu machen könnte zum Schutz dienen, um weiterem Mobbing zu entgehen, vermutet Katzer. Vielleicht legten die Jugendlichen sich aber auch eine falsche Identität zu, um sich über echte Probleme auszutauschen. Das wiederum könne Viktimisierungen geradezu provozieren, denn es signalisiert: Ich bin schwach, ich bin ein leichtes Opfer, so Katzer.
Grooming: Erwachsene machen sich an Kinder heran
Gegenüber Erwachsenen sind Kinder allerdings immer ein leichtes Opfer. Besonders gefährlich ist die sexuelle Anmache im Internet. Chatrooms, die ausdrücklich für Heranwachsende ausgewiesen sind (zum Beispiel Knuddels.de), werden auch von Erwachsenen genutzt, die sich als Jugendliche ausgeben. Die wahre Identität eines Nutzers ist für andere nicht zu erkennen. Man ist anonym, und man ist unter sich, eine Kontrolle durch den Betreiber der Website findet nicht statt. Selbst wenn ein User wegen unsittlichen Verhaltens aus dem Chatroom geworfen werden sollte, meldet er sich einfach unter anderem Namen erneut an.
Im Gegensatz zum Cyberbullying sind meist Mädchen das Ziel sexueller Übergriffe im Netz. In Catarina Katzers und Detlef Fetchenhauers Studie von 2007 gab fast jede Zweite an, bereits gegen ihren Willen nach sexuellen Dingen gefragt worden zu sein, jede Dritte war ungewollt auf ihre sexuellen Erfahrungen angesprochen worden. Von den Jungen traf dies auf 25 Prozent beziehungsweise 16 Prozent zu. Jede zehnte Chatterin war von einem Gesprächspartner dazu aufgefordert worden, sexuelle Handlungen an sich selbst vor der Videokamera auszuführen. Alarmierend sei, so Katzer, dass das Alter der Mädchen keine Rolle zu spielen scheine: Die Wahrscheinlichkeit, zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu werden oder pornografische Filme und Fotos zu erhalten, sei für zehnjährige Mädchen genauso hoch wie für 18-jährige.
Grooming nennt man es, wenn Erwachsene sich gezielt an Kinder und Jugendliche heranmachen und Vertrauen zu ihnen aufbauen, um sie später sexuell zu missbrauchen. Das funktioniert auch im Chatroom und von der Anmache im virtuellen Raum zu einer Verabredung in der realen Welt ist es nur ein kleiner Schritt. Immerhin ein Drittel der weiblichen Chatter gibt an, sich auch in der realen Welt mit anderen Nutzern zu treffen. Die Grenzen zwischen virtueller und physischer Viktimisierung verschwimmen, schreibt Katzer.
Doch das gilt nicht nur für die sexuelle Anmache im Netz. Auch das Cybermobbing hat mitunter schlimme Folgen im realen Leben die Selbstmorde in Amerika, Australien und Großbritannien zeugen davon. Der Youth Internet Safety Survey, eine große US- amerikanische Studie, für die in den Jahren 1999 und 2004 jeweils mehr als 1500 Kinder und Jugendliche befragt wurden, ermittelte, dass 23 Prozent der Opfer sich über die Vorfälle extrem aufregten und dadurch sehr belastet wurden. Die Opfer zeigten zwei- bis dreimal häufiger Symptome von Depressionen als nicht betroffene User. Auch in Katers und Fetchenhauers Studie von 2007 gab ein Drittel der Befragten an, durch die Angriffe emotional belastet zu sein und diese als sehr unangenehm zu empfinden. So waren 15 Prozent sehr verletzt, elf Prozent niedergeschlagen und acht Prozent verängstigt. Weitere Folgen waren Leistungsabfall, Schulunlust, geringes Selbstbewusstsein und Angstzustände.
Das Leiden der Opfer von Schul- und von Cyberbullying scheint dabei sehr ähnlich zu sein: In beiden Gruppen kommt es zu Stressreaktionen, psychosomatischen Beschwerden und Depressionen. Die Opfer fühlen sich einsam und sind sozial isoliert. Sie haben weniger Spaß an der Schule, werden dort öfter auffällig und schwänzen den Unterricht.
Was aber ist schlimmer, reale Gewalt in der Schule oder virtuelle Gewalt in Internet und Co? Peter K. Smith von der University of London, ein Pionier der Cyberbullying-Forschung, hat diese Frage 11- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schülern gestellt. Sie sollten angeben, ob virtuelle Demütigungen mehr, gleich viel oder weniger Auswirkungen auf die Opfer haben.
Bewertet werden sollte Bullying mittels Netzwerkplattformen wie Facebook in Chatrooms, via E-Mail, Instant Messaging wie ICQ oder Skype, per SMS oder Telefonanrufen oder das Verbreiten von Bildern und Videos. Das Ergebnis: Die Probanden stuften das Verbreiten von Bildern und Videos als deutlich schlimmer ein als Bullying in der Schule; fiese Telefonanrufe und SMS empfanden sie dagegen als weniger schlimm. Alle anderen Formen werteten sie etwa gleich negativ wie das Schulbullying. Der Hauptunterschied zur Gewalt in der Schule liege beim Cyberbullying den Schülern zufolge darin, dass der Täter oder die Täterin anonym bleibe, was die Angst verstärke. Einem unbekannten Täter gegenüber sei man hilflos, Frustration stelle sich ein. Zudem könnten sehr viele Menschen die Beleidigungen, die manipulierten oder erniedrigenden Fotos und Videos sehen, wenn sie im Internet veröffentlicht seien auf unbestimmte Zeit. Man könne ihnen nicht entfliehen. Textnachrichten hingegen seien nur Worte , die sich leichter ignorieren ließen als ein Vorfall an einem realen Ort.
Streitigkeiten hören nicht mehr am Schultor auf
Es sind dieselben Dinge, die Cyberbullying für die Opfer so schlimm und für die Täter so attraktiv machen: Die Ausübung ist denkbar einfach und schnell, innerhalb von Sekunden kann man sein Opfer diffamieren, beleidigen oder die mit einem Handy aufgenommenen Szenen ins Netz stellen und Hunderttausenden von Nutzern zugänglich machen. Der Täter selbst bleibt anonym, die Tat wahrscheinlich ungesühnt. So werde Cybermobbing auch für schüchterne, zurückhaltende Kinder und Jugendliche zur Option.
Und damit auch für eine andere Gruppe: die Opfer. Kinder, die in der Schule drangsaliert werden, rächen sich am Bildschirm zu Hause für die Demütigungen. Das Internet stellt für sie eine Möglichkeit dar, sich zu wehren. Und wer im Chatroom ignoriert oder auf Facebook beschimpft wird, der schlägt schnell mit gleicher Waffe zurück. Im Netz werden Opfer zu Tätern und Täter zu Opfern. Laut der Jugendforscherin Sonja Perren von der Universität Zürich sind beim Cyberbullying die Opfer oft auch Täter die sogenannten Täter-Opfer entpuppten sich in einer ihrer Studien sogar als die größte Gruppe unter den Bullies. In der Schule stellten sie hingegen die kleinste Gruppe; nur vier Prozent der Opfer waren hier gleichzeitig auch Täter.
Das Internet bietet mehr Spielraum für Bullying als die Schule, so Catarina Katzer. Insgesamt scheine Gewalt im Internet aber kein völlig anderes Phänomen zu sein als in der Schule. Lediglich der Handlungskontext sei verschieden Virtualität versus physische Realität, wobei beide Kontexte miteinander in Zusammenhang stünden. Das Internet ist als zusätzlicher Ort für Bullying zu sehen, sagt Katzer. Wir vermuten, dass manche zuerst im Internet bestimmte Dinge ausprobieren und diese dann in ihr echtes Umfeld übertragen das Internet also als Lernumfeld für abweichendes Verhalten nutzen. Andererseits hören viele Streitigkeiten jetzt nicht mehr am Schultor auf, sondern gehen im Internet weiter. Insgesamt nehme Bullying zu, eine Verlagerung von der Schule ins Netz also ein Rückgang der Vorfälle in der Schule finde nicht statt.
Cyberbullying nicht als normal hinnehmen
Die zunehmende Gewalt mithilfe moderner Kommunikationsmittel hat weltweit Forscher auf den Plan gerufen. Seit 2004 wird das Cyberbullying wissenschaftlich erforscht. Deutschland hinke allerdings hinterher, wie Anja Schultze-Krumbholz von der Freien Universität Berlin beklagt: Es existieren zahlreiche Studien aus dem englischsprachigen Raum, während die Forschungsarbeiten in Deutschland an einer Hand abgezählt werden können, sagte sie Ende 2009 auf dem 14. Workshop Aggression, einer Tagung der Freien und der Technischen Universität Berlin. In England und Italien zum Beispiel würden bereits Strategien zur Prävention und Intervention erprobt, während deutsche Forscher noch immer Probleme hätten, Gelder für ihre Studien zu akquirieren. Hierzulande müssen Wissenschaftler tatenlos zusehen, während sich Schüler weiter gegenseitig über moderne Kommunikationstechnologien mobben, so Schultze-Krumbholz.
Völlig untätig müssen jedoch weder Eltern noch Lehrer bleiben. Catarina Katzer rät zum Beispiel, den Computer in einen Raum zu stellen, in dem alle Familienmitglieder sich regelmäßig aufhalten, etwa das Wohnzimmer. In ihrer und Detlef Fetchenhauers Untersuchung von 2007 hat sich nämlich herausgestellt, dass 64 Prozent der im Internet sexuell bedrängten Mädchen in ihrem eigenen Kinderzimmer ins Netz gingen, aber nur 16 Prozent vom Wohnzimmer und zehn Prozent vom Arbeitszimmer der Eltern aus. Unbedingt aufmerken sollten Eltern, so der Psychologe und Mobbingexperte Gerd Arentewicz, wenn das Kind den Rechner nicht mehr mit anderen Familienmitgliedern teilen will oder schnell Browserfenster schließt, wenn jemand den Raum betritt. Warnzeichen seien auch Schulangst, Schuleschwänzen, nachlassende Leistungen, Stimmungsschwankungen und Eigenbrötelei. Arentewicz betont aber, dass man dem Kind auf keinen Fall Vorwürfe machen dürfe, weil es sonst das Vertrauen zu den Eltern verliere und die Angst vor einem Rechnerverbot überhandnehme. Eltern und Lehrer sollten laut Katzer den Jugendlichen deutlich machen, dass Cyberbullying nicht als normal hinzunehmen ist, sondern gemeldet werden muss. Oft ist den jungen Leuten nicht einmal bewusst, was sie anrichten. Was soll schon so schlimm an einem Foto sein? Oder an einer Veräppelung auf Facebook oder schülerVZ? Viele Cyberbullies hegen keine böse Absicht. Ihre Taten erinnern an Dummejungenstreiche, die wir alle aus unserer Jugend kennen. Die Folgen, wenn das Geschehen mittels der neuen Medien hinaus in die Welt getragen wird, sind heute allerdings um ein Vielfaches schlimmer.
Cyberpolizei an Schulen?
Insgesamt ist es wichtig, die Medienkompetenz sowohl der Kinder als auch der Erwachsenen zu steigern. Die meisten Eltern haben keine Ahnung, was ihren Kindern im Internet passiert, so Katzer. Es ist immens wichtig, den Kindern auf den Fersen zu bleiben, was das technische Know-how und das Wissen um Trends bei Internet und Handy angeht. Dabei will ihnen die Initiative Schau hin! Was Deine Kinder machen helfen (www.schau-hin.info). Die Kampagne des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend informiert über alle möglichen Themen der Internetsicherheit, unter anderem zu den Themen Kindersicherung, Chatten und Handygewalt (weitere Internetadressen am Ende des Artikels).
Gerd Arentewicz empfiehlt auch, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, was über das eigene Kind im Internet zu finden ist. Dazu gibt man den Namen des Kindes bei Suchmaschinen wie Google oder Yasni ein. Je nach Ergebnis kann man dann bei den jeweiligen Anbietern die Entfernung der Inhalte beantragen.
Da Gewalt auf dem Schulhof und im Netz zwei Facetten derselben Problematik sind, sollten auch Präventionsprogramme in der Schule unbedingt die virtuelle Welt einbeziehen, etwa bei Antigewalttrainings. Katzer schlägt zudem eine Cyberpolizei an Schulen vor, die von den Kindern selbst ausgeübt wird und an die Betroffene sich wenden können, zum Beispiel anonym über das Internet. Handyverbote an Schulen, um etwa das Verbreiten von Gewaltvideos zu unterbinden, haben sich jedoch als wirkungslos herausgestellt sie verschieben die Aktivitäten lediglich in die Freizeit.
Verboten ist verboten
Auch die Politik und die Wirtschaft tun etwas. In Deutschland gibt es bereits seit 2004 ein verschärftes Sexualstrafrecht, das es verbietet, Kinder im Internet zu sexuellen Handlungen anzustiften oder ihnen pornografisches Material zu senden. Die EU plant, das Grooming, also das Anbahnen von sexuellen Kontakten mit Kindern, unter Strafe zu stellen. Sie hat mit Insafe ein Netzwerk gegründet, das sich um die Verbesserung der Sicherheit im Netz kümmert und unter anderem mit einem jährlichen Safer Internet Day auf das Problem aufmerksam macht. Und das durchaus erfolgreich: 17 Betreiber von Internetplattformen, darunter Facebook und studiVZ, haben eine Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet. Sie wollen ihren Nutzern in Zukunft genauere Anleitungen zum Verhalten auf den Portalen geben, die Funktionen zur Meldung von Missbrauchsfällen verbessern und speziell aufbereitete Informationen für Eltern anbieten. Durch rigidere Datenschutzeinstellungen soll es besser möglich sein, eigene Daten vor dem Zugriff durch Fremde zu bewahren. Auch die Mobilfunkanbieter und Chatbetreiber informieren auf ihren Websites über Jugendschutz, Kindersicherungen und Datenschutz.
Grundsätzlich ist im World Wide Web all das verboten, was auch im normalen Alltag des realen Lebens verboten ist, schreibt der Psychologe Gerd Arentewicz. Es gibt in Deutschland durchaus Gesetze, mit denen Mobbing im Internet belangt werden kann, zum Beispiel Tatbestände zu Beleidigung, Verleumdung oder zur öffentlichen Zurschaustellung einer fotografierten Person. Im Zweifel sei es nie verkehrt, die Polizei einzuschalten, rät Arentewicz, der seit Jahren zu Konflikten am Arbeitsplatz und in der Schule forscht. Doch selbst eine Anzeige und ein Gerichtsprozess helfen nicht unbedingt weiter, wie der Fall der 50-jährigen Lori Drew aus Missouri zeigt: Das Urteil gegen sie wurde letztlich doch noch von höchster Stelle aufgehoben. Der Richter betonte, es sei nicht davon auszugehen, dass jeder die umfangreichen Nutzungsbedingungen der verschiedenen Plattformen lese, und dass man außerdem nicht jeden kriminalisieren könne, der sich unter falschem Namen im Internet anmelden. Lori Drew ist die Frau, die gemeinsam mit ihrer Tochter zum Selbstmord der 13-jährigen Megan Meier beigetragen hat.
Literatur
Gerd Arentewicz, Alfred Fleissner, Dieter Struck: Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz, in der Schule und im Internet Tipps und Hilfsangebote. Ellert & Richter, Hamburg 2009 Stiftung Warentest: Kindheit 2.0. So können Eltern Medienkompetenz vermitteln. Berlin 2009
Internetadressen
- www.jugendschutz.net: Die Website des Jugendschutzes im Internet
- www.klicksafe.de: Initiative der EU mit Informationen, Links und Materialien für Lehrer
- www.internet-abc.de: Informationen zum Thema Medienkompetenz für Eltern und Kinder
- www.schau-hin.info: Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; mit Hotline
Hinweis: Der Artikel, ursprünglich erschienen in der Zeitschrift Psychologie Heute, kann abschnittsweise kommentiert werden. Informationen und die laufenden Diskussionen zum #pxp_thema "Aggressionen im Netz" findet ihr hier.
Foto & Teaser: FUMIGRAPHIK (CC BY-NC-ND 2.0)