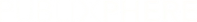»Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, Die eine will sich von der andern trennen; Die eine hält, in derber Liebeslust, Sich an die Welt mit klammernden Organen; Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den Gefilden hoher Ahnen.« Goethe, Faust I

Wie oft in der deutschen Ideengeschichte, findet auch diese Erzählung ihren Anfang in den Versen Goethes. Die Wanderung entlang des inneren Abgrunds ist nicht nur das Leitmotiv des Faustdramas. Sie wird zur fortgeltenden Metapher deutscher Selbstbetrachtung. Die Nation als Körper, in dessen Brust zwei Seelen wohnen – eine Gedankenfigur, die sich durch zwei Jahrhunderte deutscher Geschichte zieht. Friedrich Schlegel klagt: »Trostlos steht die Lücke vor uns: der Mensch ist zerrissen, die Kunst und das Leben sind getrennt.« Die Dichter des Sturm und Drang stellen die innere Zerrissenheit des Menschen, der in der aufgeklärten Welt zwischen Verstand und Gefühl um Versöhnung ringt, in den Mittelpunkt ihres Schaffens. Doch die Metapher der Trennung, des Doppelten und Widersprüchlichen hat keineswegs nur geistige Bedeutungskraft. Schillers Räuber schreiten vom bloßen Idealismus über zur Tat, denn allein »Träume bedeuten nichts«. Schritt für Schritt wird das Hin- und Hergerissensein, nur scheinbar losgelöst von seiner poetischen Betrachtung, zur politischen Kategorie. Schon Höldlerins Hyperion schreibt an seinen deutschen Freund Bellarmin, er könne sich kein Volk vorstellen, »das zerrißner wäre, wie die Deutschen«. Und meint damit nicht nur die in Fürstentümer und Kleinstaaten zersplitterte äußere Nation. Der innere Abgrund, den Nationaldichter und -Denker zu erkennen meinen, bringt die Deutschen immer wieder dazu, im Spiegel ihrer selbst mehr als eine Person wahrzunehmen. Heinrich Heine bemerke in seinen Reisebildern höchstselbst, dass durch sein Herz »der große Weltriß« ginge. Eine Formulierung, die die Madame de Staël dazu verführt, nur halb spöttisch zu bemerken, die Deutschen hätten immer etwas mehr Gedanken im Kopf, als sie aussprechen können. Thea Dorn und Richard Wagner widmen in ihrem Band »Die deutsche Seele« dem Begriff der »Zerrissenheit« ein gekonntes Kapitel: »Das Höchste ist mir gerade hoch genug. Mein Geist versenkt sich ins Unaussprechliche. Und wühlt nach Worten.«
Wenn ein »unaussprechliches« Selbstbild überleben will, muss es sich hie und da mit der Wirklichkeit versöhnen. In der Not auch mit der politischen. Thomas Mann entfernt zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Seele aus der kraftgeschwellten Brust des Kaiserreichs, um es auf der anderen Seite des Schlachtfeldes zu verorten. Jenseits des Rheins, nördlich des Ärmelkanals und westlich des Atlantiks; Dort würden »Zivilisation, Gesellschaft, Stimmrecht, Literatur« vorherrschen, wohingegen »Deutschtum … Kultur, Seele, Freiheit, Kunst« bedeute, schreibt er in seinen »Betrachtungen eines Unpolitischen«. Die »Ideen von 1914« bahnen sich unter Vermischung überlieferter Ideenhistorie mit wohlgepflegten Ressentiments ihren Weg in die Köpfe des Bürgertums. Entlang einer eigenwilligen Interpretation vergangener Geistesgrößen, errichtet Thomas Mann ihr theoretisches Fundament. Er beruft sich auf Dostojewski, der den angeblichen »wesentlichsten Zug« der Deutschen darin zu erkennen meint, »daß sie sich niemals … mit der äußersten westlichen Welt haben vereinigen wollen«. Sie würden seit ganzen zweitausend Jahren gegen diese Welt protestieren, schreibt dieser in seinem Aufsatz über das »ewig protestierende Reich«. Das erklärte Ziel des frühen Thomas Manns ist es, eine Art Unvereinbarkeitsdiktum zu etablieren, das Deutschland und den Westen fundamental und ewiggültig voneinander scheiden sollte. Es ist in Wahrheit der Versuch, die traditionsreiche Trennungslehre der »deutschen Seele« kriegstauglich umzurüsten. Die innere Zerrissenheit wird zur äußeren Konfrontation, ja zur vaterländischen Pflicht deutscher Geistlichkeit. Zu einem Bruch kommt es nach dem verlorenen Krieg nicht. Im Gegenteil: Die sogenannten »Konservativen Revolutionäre« der Weimarer Republik berufen sich auf eine angebliche »Ordre de coeu«, einer existenziellen Substanz, die konträr zum westlichen Liberalismus formuliert werden müsse. Oswald Spengler verkündet ein Jahr nach Kriegsende: »Wir brauchen die Befreiung von den Formen der englisch-französischen Demokratie. Wir haben eine eigene.« Martin Heidegger, der von 1915 bis 1918 in Kriegsdienst gestanden hatte, deutet noch 1943 den Nationalsozialismus analog zum Zweiten Weltkrieg als Verteidigungskampf von »Abendland« und »Deutschtum« gegen die »große Bedrohung … von Bolschewismus und Amerikanismus«.
Doch die Umdeutung der poetischen, inneren Zerrissenheit zum politischen Kampf des »überzeitlichen Deutschlands« wider westlich-liberaler Einflüsse, findet auch nach 1945 keinen Abbruch. Es ist diese Art der Interpretation der oft schwierigen und widersprüchlichen deutschen Selbstbetrachtung, aus der die sogenannte »Neue Rechte« ihr ideologisches Kapital bezieht. In einem Briefwechsel mit Armin Nassehi spricht einer ihrer gegenwärtigen »Vordenker«, Götz Kubitschek, von einer totalitär gesetzten »ethno-kulturellen Identität«. Er beschreibt sie als »überkonstitutionell und unhintergehbar«. Brisant wird das Gedankengebäude der sogenannten »Konservativen Revolution«, weil ihre metaphysischen Konstruktionen mit dem Rechtspopulismus unserer Zeit wieder in die Debatten und Parlamente hineindiffundieren. Auf einem AfD-Parteitag vernimmt man aus dem Mund der Parteichefin, dass »unser aller Identität … vorrangig kulturell determiniert« sei und daher »nicht dem freien Spiel der Kräfte ausgesetzt werden« dürfe. Das »freie Spiel der Kräfte«? Eine Anspielung auf den menschenrechtlichen, individualistischen Freiraum, den das Grundgesetz vorfindet, um ihn »Aller Staatsgewalt« zum Schutze aufzutragen. Bekanntlich kennt die bundesdeutsche Verfassung ja keine »ethnische« oder »kulturelle« Disposition. »Kultur« im Widerspruch zu den »nur rechtlichen Normen«, die Religionsfreiheit und Asylrecht gleichermaßen garantieren - um diese Entgegensetzung dreht sich die scheinbürgerliche Neuerzählung der alten deutschen Trennungslehre Mann’scher Machart. Hier »Kultur«, dort bloße »Zivilisation«. Im Zweifelsfalle sticht erstere die letztere aus. Alexander Dugin, als »Ideengeber Waldimir Putins« bekannt geworden, erzählt die Unvereinbarkeitsgeschichte mit eurasischem Fluchtpunkt – und findet damit Anklang bei europäischen Neonationalisten. Für ihn ist die Bundesrepublik »eine Art Gegen-Deutschland«, das sich von seinen »kulturellen Wurzeln verabschiedet« habe und zu einer »degradierten Zivilisation« verkommen sei. Eine ähnliche Erzählung bedient Alexander Gauland auch in einer Rede vor dem deutschen Burschenschaftstags. Der Parteisprecher setzt »die Realität des Staates und die Bewegungsgesetze seiner Gesellschaft« explizit in den »vorpolitischen Raum«, in den der von ihm verachtete Verfassungspatriotismus nicht hineinlangen könne. Aus jener Konstruktion des Vorpolitischen leitet die rechtspopulistische Bewegung in der politischen Debatte wesentliche Forderungen ihres Programms ab: Etwa die willkürliche Einschränkung der Religionsfreiheit deutscher Muslime oder die Schließung der deutschen Grenze unabhängig menschenrechtlicher Verpflichtungen. Die Erzählung der »zerrissenen deutschen Seele« findet als politische Um- und Fehldeutung erneut Platz in einer bundesrepublikanischen Partei. Ihr ideologisches Leitmotiv formt eine mystische Letztbegründung; Dass sich jenseits der normativen Oberfläche das Eigentliche befinde: »Das Volk« und »seine Kultur«.
Spricht es hier wieder, das »ewig protestierende Reich«, das angeblich ein antiwestliches sei? Ist die behauptete Unvereinbarkeit deutscher und westlicher Staatsphilosophie letztendlich vielleicht doch unhintergehbar? Man sollte diese apokalyptisch anmutende These genauer prüfen. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit kann ein genaueres Bild liefern, ob sich die westlich-deutsche Zerrissenheit auch in der Selbstbetrachtung auf der Zeitachse wiederfindet: Heute wenden sich die Historiker dem ständischen Gebilde des »Alten Reichs« wohlwollend zu. Es kann kaum imperialistisch expandieren. Das unterscheidet es von seinen westlichen Nachbarn. Hinzu kommt, dass es neben Polen-Litauen das einzige Großreich Europas ist, das durch eine Wahlmonarchie geführt wird. Die starken Kurfürsten bewahren sich über fast ein Jahrtausend hinweg ihre Wahlprivilegien und verhindern so einen Unitarismus französischer und britischer Machart. Ein gesamtdeutscher Absolutismus kann nie entstehen. Der Dichter und Paulskirchenabgeordnete Ludwig Uhland lehnt 1849 in einer seiner bedeutendsten Reden in der Nationalversammlung den Zentralismus und das Erbkaisertum gleichermaßen ab. Mit den Worten: »Ursprünglich deutsch ist diese Staatsform nicht«, plädiert er für die Erhaltung des »Guten Alten Rechts«: der demokratischen Wahl. Ein Unterschied zum hegemonialen Frankreich und aufstrebenden Großbritannien, gewiss – doch ein Widerspruch zu westlichen Ideen? Immerhin speist sich die moderne Form des bundesrepublikanischen Föderalismus aus dieser Traditionslinie; Eine vertikale Form der Gewaltenteilung, die keineswegs evidentermaßen weniger »westlich« ist als der etatistische Zentralismus. Der »immerwährende Reichstag«, die ständische Wurzel des deutschen Parlamentarismus, ragt bis in die Gegenwart hinein. Ebenso die deutsche Rechtsstaatstradition und stadtrepublikanische Spielart der kommunalen Selbstverwaltung. Auch die schon früh in der Bundesrepublik etablierte Lehre vom Recht als »objektive Werteordnung« führt eine liberale Tradition deutscher Staatlichkeit fort, die selbst mit dem britischen Begriff der Parlamentssouveränität unvereinbar wäre. Jean-Jacques Rousseau schreibt 1752 in seinem »Auszug auf dem Entwurf zum Ewigen Frieden«: »Das öffentliche Recht, das die Deutschen so gründlich studieren, ist somit noch weit wichtiger, als sie glauben, denn es ist nicht allein das germanische öffentliche Recht, sondern in gewissem Sinn das von ganz Europa.« Sind dies nur Ausrutscher in der Historie einer sonst ganz andersgearteten »deutschen Seele«? Diese Geschichte erscheint lanciert. Bestünde ein Gegensatz, so müsste dieser später konstruiert worden sein – und er wäre dann kein fundamentaler. Wenn sich auch die zur liberalen Fortentwicklung fähigen Ansatzpunkte im Laufe des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts nicht durchsetzen, so wäre es mindestens verfehlt hier eine grundsätzliche Unvereinbarkeit zu konstatieren. Im Gegenteil: Die Erfindung einer angeblichen Dichotomie »westlicher« und »deutscher« Gesellschaftsphilosophie in den späteren Jahrzehnten nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution, dürfte maßgeblich zum Abhandenkommen deutsch-liberaler Zivilisationsideale beigetragen haben. Deren geistige Anfänge lassen sich jedoch sowohl im Sturm und Drang als auch in der Romantik finden.
Unter dem Eindruck hoher Flüchtlingszahlen hat sich das Land seit mindestens einem Jahr erneut und intensiver auf Identitätssuche begeben. Die nun ein Vierteljahrhundert zurückliegende Wiederherstellung des deutschen Nationalstaats begünstigt offenbar heute den Wunsch nach umfangreicherer Selbstbetrachtung. Die Titel häufen sich: »Was ist deutsch?«, wer soll es sein, wer kann es sein? Und sie gleichen sich in dem Gegenstand den sie behandeln: Was ist dieses Deutschland? Ein Staat mit »Leitkultur«? Eine multikulturelle Staatsbürgernation? Eine Rechtsgemeinschaft? Allerorten erklingt der Ton vergessener Zeiten: Die Fragen nach der »Kultur«, der Religion, der Verfasstheit dieses Landes. Identitätsdebatten sind meist schwer zu fassen. Der Satz, Deutschland müsse Deutschland bleiben, wird dabei zitiert. Er enthält aber eine Leerformel, die nach weltanschaulicher Deutung verlangt. Ein konservativer Begriff der hingegen in dieser Debatte auftaucht: Die »deutsche Leitkultur«. Sie soll eine diffuse Bezeichnung für all das darstellen, was aus der »christlich-jüdisch-abendländischen Tradition« noch fortgelten solle. Aus dem Setzen eines Leitbildes folgt die Auseinandersetzung mit der Einwanderungsgesellschaft. Deutscher sein hieße dann, sich langfristig dieser Tradition anzunähern. So versöhnt sich das konservative Gesellschaftsbild mit den Gegebenheiten der Migration und schlägt gleichzeitig einen kulturellen Kurs für das windige Zeitalter der Globalisierung vor – Ein Schachzug der Selbstdefinition. Doch ist dies auch eine Absage an den Universalismus? Das fragt ein Kommentator in der »Zeit« und warnt: »Unser Selbstverständnis steht hier auf dem Spiel«. Denn wo sich eine »Kultur« als leitend definiere, sei Zwang zu eben jener schon einprogrammiert. Vermutet wird »Deutschtümmelei«, die die »Ausdifferenzierung der Gesellschaft« nicht begriffen habe, ja sie sogar autoritär bekämpfe. Eine andere Journalistin bringt ihre Skepsis juristisch auf den Punkt: »Reicht es nicht, wenn sich alle … dem Grundgesetz verpflichten?« Es schwingt die Sorge mit, jeder Identitätsdiskurs, der über unsere Verfassung hinausginge, bedeute die Abkehr von westlichen Ziviliationsstandards wie dem Prinzip der Staatsbürgernation. Der Wiederetablierung anti-universalistischer Normen, im Geiste der überwunden geglaubten »zweiten deutschen Seele«, gilt einige Befürchtung. Ein hoher Parlamentarier der Sozialdemokraten erklärt in einem journalistischen Aufsatz, »warum es in Deutschland keine Leitkultur geben« könne. Die Angst vor dem »ewig gegen den Westen protestierenden Reich« blüht in diesen Zeiten. Die Warnungen stehen nicht ohne Kontext. Botho Strauß‘ »Anschwellender Bocksgesang«, der in den 1990ern den Auftakt für eine Reihe rechtskonservativer Publikationen spielte, von der »Selbstbewußten Nation« zur »Berliner Republik«, liegt noch nicht allzu lange zurück.
Doch die antizipative Argumentation kann dem neurechten Denken in die Hände spielen. Wenn der Verfassungspatriotismus gegen eine »Leitkultur« in Stellung gebracht wird, läuft er Gefahr die Unterstellung zu wiederholen, die Bundesrepublik müsse als Antithese zur »deutschen Kultur« begriffen werden. Ein Fenster für allerlei Zerrissenheitstheorien öffnet sich. Ein Frontmann der deutschen Rechtspopulisten warnt vor laufender Kamera, die »Dimension des Asylrechts« begreife nicht die »Gefährdung der Nation im Ganzen«. Daher müsse man auch jenseits der juristischen Normen Maßnahmen ergreifen. Gleicht diese Trennung von Nation und Recht dem Identitätsentwurf konservativer Machart? Ein grundsätzlich gegen kollektivistische Deutungen aversiver Charakter kann diese Frage übergehen. Aber es liegt nahe derlei Vermengung zu verneinen. Andernorts bemächtigt man sich selbst der Deutungskraft: Die »Leitkultur« als linker oder liberaler Begriff. Die Scottish National Party verfolgt das Konzept des »inklusiven Nationalismus«. In einer bemerkenswerten Rede bekennt die Parteichefin: »Wie schaffen und erhalten wir eine inklusive, prosperierende, soziale und weltoffene Nation? Das ist die Frage unserer Zeit – und wir sind bereit uns ihr zu stellen!«. Die Versammelten sind sichtlich begeistert, sogar Nicht-Parteimitglieder erscheinen zu ihren Veranstaltungen in hoher Anzahl. Sie bekennen sich zu den Ideen der schottischen Sezessionisten, die einen sozialstaatlichen Kommunitarismus mit einer harschen Ablehnung der Tory-Regierung in London kombinieren - bei gleichzeitig bekenntnisfreudiger Hinwendung zu Europa. Die Partei ist dabei nicht wenig erfolgreich. 2016 verfehlt sie nur knapp die absolute Mehrheit. Dem kanadischen Premierminister liegt der Begriff des »Nationalismus« ferner, obwohl auch er, als er im letzten Jahr seine linksliberale Partei von dem dritten auf den ersten Platz führt, auf ein kanadisches Wir-Gefühl setzt. In begeistert aufgenommenen Wahlkampfreden nennt er Kanada ein »postnationales Land«, das aber umso stärker gemeinsame Werte teile, »die in Humanität, Solidarität, Weltoffenheit und Zusammenhalt ihren Ausdruck« fänden. Justin Trudeau gewinnt die Wahl mit Forderungen, die derzeit in Kontinentaleuropa undenkbar sind: Die Einrichtung von »Willkommenszentren« zur Aufnahme mehrerer Tausend Flüchtlinge. Er erreicht dies nicht mit juristischen Warnungen vor dem konservativen Konkurrenten. Seine Letztbegründungen speist er vielmehr aus bewusst gesetzten Werten, zu deren Bekennung er die kanadische Zivilgesellschaft ausdrücklich auffordert. Von deutscher Seite reicht an den linken Identitätsbegriff am ehesten der Entwurf Carolin Emckes heran, »Vielfalt in der Gesellschaft nicht nur zu dulden, sondern zu feiern.« Wertsetzungen kennt auch die bundesdeutsche Geschichte nicht nur von der Rechten. Die Brandt’sche Parole, man wolle »mehr Demokratie wagen« ist kein ängstlicher Verfassungspatriotismus. Die Linke der 70er Jahre fasst den Mut, ihr eigenes Selbstbild dieser Republik vorzulegen: Demokratisierung, Solidarität, Emanzipation, Versöhnung mit dem Osten. Der Künstler Georg Meistermann notiert zu der Person Brandt: »Er ist der erste deutsche Staatsmann, der wie seit langem kein Vorgänger den Mut zu neuen Entwürfen hat.« Dieser fordert selbst zeitlebens von allen progressiv Bewegten: »Unsere Zeit steckt, wie kaum eine andere zuvor, voller Möglichkeiten. … Nichts kommt von selbst. Darum - besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, daß jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.« Diese »Leitkultur« kann man in keinem Grundgesetzkommentar nachlesen. Sie ist genuin politischer Natur. Die nach Worten wühlende Bestimmung, was »deutsch« im letzten Sinne bedeuten solle, erscheint aussprechbar, ohne einen Pakt mit Mephisto einzugehen.