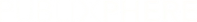„Machen es sich die EU-Föderalisten zu einfach?“, heißt es im Teaser dieses Beitrags von Michael Wohlgemuth, und für jemanden, der wie ich ein Blog mit dem Namen Der (europäische) Föderalist schreibt, ist das a priori natürlich eine beachtenswerte Frage. Einfach macht es sich stattdessen aber erst einmal Herr Wohlgemuth selbst, indem er keineswegs föderalistische Positionen kritisiert, sondern die überaus intergouvernementalistisch inspirierten Vorschläge der deutschen und der französischen Regierung zur Reform der Währungsunion.
Herr Wohlgemuth mag diese Vorschläge nicht, da sie ihm zu politisch-interventionistisch sind; lieber wäre ihm eine bloße „Wirtschaftsverfassung“ in Form eines vorab festgelegten Regelwerks, das dann durch „automatische Sanktionen“ bzw. durch „unabhängige Organe“ durchgesetzt wird. So viel Glauben an die Weisheit eines (unpolitischen?) Verfassungsgebers und an die „unabhängigen“, also ungewählten Technokraten, die dessen Willen durchsetzen sollen, ist bewundernswert. Besonders demokratisch ist diese Vision indessen nicht. (Und dass eine Währungsunion ohne automatische Stabilisatoren wie eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung auch rein ökonomisch wenig Überlebenschancen hat, sei hier nur am Rande erwähnt.)
Das Grundgesetz ist nicht die Bibel...
Aber zurück zu den Plänen einer politischen Union. Völlig zu Recht merkt Wohlgemuth an, dass das Bundesverfassungsgericht sich einer weitgehenden Übertragung von Fiskalkompetenzen auf die EU bislang vehement entgegenstellt. Wo genau Karlsruhes rote Linien dabei liegen, sei hier dahingestellt – anders als Wohlgemuth suggeriert, dürfte eine europäische Arbeitslosenversicherung oder eine gemeinsame Einlagensicherung durchaus auch mit dem heutigen Grundgesetz vereinbar sein. Grundsätzlich aber gilt natürlich, dass das Grundgesetz nicht die Bibel ist und das Bundesverfassungsgericht kein Prophet: Wenn wir zu einem Punkt kommen, an dem es rechtlich notwendig und zugleich politisch-demokratisch geboten ist, die heutige deutsche Verfassung durch eine neue zu ersetzen, dann sollten wir nicht zögern, diesen Schritt auch zu tun.
Nun versteht es sich von selbst, dass eine umfassende politische Union, ein europäischer Bundesstaat, eine ausreichende demokratische Legitimation braucht – und nun endlich erreicht Wohlgemuths Argumentation tatsächlich das Terrain der europäischen Föderalisten, die in den 1970er Jahren die Ersten waren, die das Demokratiedefizit der damaligen Europäischen Gemeinschaften kritisierten. Das Argument, dass im heutigen Europawahlsystem nicht alle Stimmen gleich gewichtet werden, lässt sich allerdings kaum gegen die Föderalisten verwenden. In der aktuellen Debatte über eine europäische Wahlrechtsreform sind schließlich gerade sie es, die einen konkreten Vorschlag präsentieren, um diesem Problem abzuhelfen: Die Lösung, mit der das „Eine-Stimme-pro-Person“-Prinzip europaweit umgesetzt werden könnte, heißt transnationale Listen.
Eine europäische Öffentlichkeit existiert in Grundzügen
Demokratie europäisch neu gestalten
Bleibt Wohlgemuths letzter Punkt: Um ihre Ziele zu begründen, müssten die Föderalisten „eine pan-europäische Öffentlichkeit, Identität und Solidarität und damit entgegen empirischer Evidenz die Entstehung eines funktionierenden pan-europäischen Parteiensystems imaginieren oder simulieren“.
Darauf ließe sich nun mit zweierlei Argumenten antworten: Zum einen kann man auf die umfassende sozialwissenschaftliche Forschung verweisen, die in den letzten Jahren empirisch dargelegt hat, dass eine europäische Öffentlichkeit tatsächlich bereits in Grundzügen existiert und sich weiter verdichtet. Man kann die Logik des Mediensystems erläutern, das vor allem über Ereignisse berichtet, die sich dramatisieren, personalisieren und in klare Konfliktmuster fassen lassen – lauter Dinge, in denen die heutige EU eher schlecht ist, die aber bei einer umfassenden politischen Union durchaus gegeben wären. Und man kann die Hebel benennen, die ein funktionierendes gesamteuropäisches Parteiensystem braucht: Um als politische Akteure an Bedeutung zu gewinnen, müssten die gesamteuropäischen Parteien endlich die Macht über wichtige personalpolitische Entscheidungen bekommen. Und das geht wiederum durch transnationale Europawahllisten sowie eine Wahl der Kommission allein durch das Europäische Parlament – zwei Kernforderungen der europäischen Föderalisten zur institutionellen Reform der EU.
Demokratie europäisch neu gestalten
Man kann Wohlgemuth jedoch auch noch auf andere Weise antworten, nämlich mit der Frage nach den Alternativen. Wie der Ökonom Dani Rodrik mit seinem „Globalisierungs-Trilemma“ aufgezeigt hat, lassen sich nationale Souveränität und Demokratie nur so lange miteinander vereinbaren, wie auch die Märkte weitgehend national bleiben. Sobald man die Grenzen für ein staatenübergreifendes Wirtschaftssystem öffnet, geraten die Staaten in eine solch starke wechselseitige Abhängigkeit, dass eigenständige nationale Entscheidungen zunehmend unmöglich werden. Der Versuch, dennoch an den Formen der nationalen Souveränität festzuhalten, führt zu dem, was Rodrik eine „goldene Zwangsjacke“ nennt: eine Entleerung des demokratischen Handlungsspielraums, ein Diktat der wirtschaftlichen „Sachzwänge“, eine Welt der politischen „Alternativlosigkeit“.
Wer sich wie Michael Wohlgemuth mit einer bloßen überstaatlichen „Wirtschaftsverfassung“ ohne demokratische Kontrolle und Interventionsmöglichkeit wohl fühlt, für den mag dieses Modell eine Option sein. Alle anderen sollten hoffen, dass der Brückenschlag zwischen grenzüberschreitender Wirtschaft einerseits und demokratischer Politik andererseits gelingt. Auch wenn das bedeutet, althergebrachte Formen der Nationalstaatlichkeit zu überwinden und die Demokratie auf europäischer Ebene neu zu gestalten. Genau hierin liegt das Ziel der europäischen Föderalisten. Und einfach machen sie es sich damit nicht.