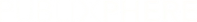Sicherheitspolitik
 Deutsche Soldaten bei ihrer Verabschiedung in den Auslandseinsatz nach Bosnien-Herzegowina und in den Kosovo (April 2004). © picture alliance / AP Photo
Deutsche Soldaten bei ihrer Verabschiedung in den Auslandseinsatz nach Bosnien-Herzegowina und in den Kosovo (April 2004). © picture alliance / AP Photo
Wie lassen sich Staatsgrenzen sichern und gewaltsame Konflikte vermeiden? Mit Friedensabkommen, humanitären Maßnahmen oder Militäreinsätzen? Die Sicherheitspolitik sucht seit Jahrzehnten nach Antworten. Von Alexander Wragge
Laufende Debatte zum Thema:
Starte deine eigene Debatte zum Thema
Was bedeutet Sicherheitspolitik?
Unter dem Begriff Sicherheitspolitik werden klassischerweise Maßnahmen gefasst, die Staaten schützen sollen – vom Militär-Einsatz bis zum Abrüstungsabkommen.
Wichtige multinationale Akteure der Sicherheitspolitik sind die Vereinten Nationen und ihr Sicherheitsrat, die Nordatlantische Allianz (NATO), die Europäische Union mit ihrer Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) und die Afrikanischen Union (AU). Hinzu kommen zahlreiche Militärbündnisse, die allerdings selten in Erscheinung treten.
Die Themenspektren und Instrumente der Sicherheitspolitik werden zunehmend vielfältiger. Der sicherheitspolitische Ansatz der „Vernetzten Sicherheit“ bündelt beispielsweise zahlreiche nationale und internationale Maßnahmen gegen bewaffnete Konflikte in Krisenregionen – von der Diplomatie über den militärischen Eingriff bis zu humanitären Einsätzen. Auch werden immer mehr Faktoren in den Blick genommen, die für die Sicherheit wichtig erscheinen. So befasst sich etwa die deutsche Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) auch mit dem Klimawandel und Finanzkrisen.
Zahlreiche Institutionen forschen in Deutschland zu sicherheitspolitischen Fragen (Liste), darunter die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), das Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK) und die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). [weniger anzeigen]
Aktuelle Fragen der Sicherheitspolitik
Derzeit stehen Auseinandersetzungen in der Ukraine, Syrien und afrikanischen Staaten im Zentrum der sicherheitspolitischen Debatte. Europa diskutiert eine gemeinsame Armee. Auch die Cyber-Sicherheit bleibt auf der Agenda.
Krise in der Ukraine
Der Regierungsumsturz in der Ukraine hat eine internationale Krise ausgelöst. Moskau schickt Soldaten auf die Krim. Die internationale Staatengemeinschaft sucht eine friedliche Lösung.
Machtwechsel in Kiew
Die gegenwärtige Krise nimmt 2013 ihren Anfang. Ende November setzt die ukrainische Regierung von Präsident Viktor Janukowytsch ein Assoziierungsabkommen mit der EU aus. Daraufhin kommt es zu monatelangen Protesten auf dem Maidan-Platz in Kiew (sie werden auch unter dem Begriff „Euromaidan“ gefasst). Neben Befürwortern einer engen EU-Anbindung demonstrieren auch Nationalisten und Ultra-Nationalisten (Siehe auch ARD-Hintergrund: „Parteien der Ukraine“).
Mitte Februar 2014 kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Sicherheitskräfte feuern in Kiew auf Demonstranten. Berichtet wird von bis zu 100 Todesopfern. Angesichts der Ereignisse handeln Regierung und Opposition Neuwahlen im Mai aus. Auch soll eine frühere Verfassung in Kraft treten, die dem Präsidenten weniger Befugnisse zubilligt. Die Außenminister Deutschlands, Polens und Frankreichs und ein Gesandter Russlands vermitteln bei den Gesprächen.
Kurz darauf flieht Janukowytsch aus Kiew. Am 22. Februar setzt das Parlament ihn als Präsidenten ab. Janukowytsch will seine Amtsenthebung nicht anerkennen. Von Russland aus wirft Janukowytsch den Vermittlern aus dem Westen Wortbruch vor. Zugleich kommt die frühere Präsidentin und Oppositionelle Julija Timoschenko frei. Sie war zwei Jahre lang wegen Amtsmissbrauchs bei Gasgeschäften inhaftiert, sah sich selbst aber als politische Gefangene. Timoschenko will im Mai wieder für das ukrainische Präsidentenamt kandidieren, genauso wie der Boxweltmeister und Politiker Vitali Klitschko.
Bis zur Wahl übernimmt eine Übergangsregierung die Geschäfte. Als Interimspremier wird der ehemalige Parlamentspräsident, Wirtschafts- und Außenminister Arsenij Jazenjuk vereidigt. Interimspräsident wird der Timoschenko-Vertraute Alexander Turtschinow.
Krim-Krise
Russland spricht von einem „Staatsstreich“ in der Ukraine. Im Gegensatz zu EU und USA bezweifelt Moskau zunächst die Rechtmäßigkeit der neuen Regierung.
Wenige Tage nach dem Machtwechsel verlegt Russland – laut Angaben der ukrainischen Interims-Regierung – zunächst 6.000 zusätzliche Soldaten auf die ukrainische Halbinsel Krim. Die Sicherheit der dort lebenden Russen sei gefährdet, so die Begründung. Das russische Parlament hat dem unbefristeten Armeeeinsatz auf ukrainischem Gebiet einstimmig zugestimmt.
Als Reaktion auf die russischen Truppenbewegungen versetzt die Übergangsregierung in Kiew die ukrainische Armee in Alarmbereitschaft. Übergangspremier Jazenjuk spricht von einer „ Kriegserklärung“. Der ukrainische UN-Botschafter fordert die USA, Großbritannien, Frankreich und China auf, die Souveränität der Ukraine zu garantieren. Nach Angaben der US-Regierung sollen mittlerweile rund 20.000 Soldaten auf der Krim stationiert sein (Stand: 17.Mäz 2014).
Auf der Krim ist traditionell die russische Schwarzmeerflotte stationiert. Die rund zwei Millionen Krim-Bewohner sind mehrheitlich ethnische Russen. Der sowjetische Generalsekretär Nikita Chruschtschow hatte die Krim 1954 der ukrainischen Sowjetrepublik übertragen. Der größte Teil der Halbinsel gehört zur Autonomen Republik Krim, einer eigenständigen Region innerhalb der Ukraine.
Nach dem Machtwechsel in Kiew sind auf der Krim Anhänger und Gegner eines pro-russischen Kurses aneinander geraten (Siehe auch Chronologie der Krim-Krise). Die sogenannten Krimtataren (zur komplizierten Zusammensetzung und Geschichte dieser Volksgruppe siehe den Eintrag auf Wikipedia) wenden sich gegen die Annäherung an Russland. Bei der russischen Bevölkerung erregt ein Gesetzentwurf der Übergangsregierung in Kiew Aufsehen, Russisch als Amtssprache landesweit abzuschaffen. Allerdings zieht Kiew den Entwurf wieder zurück.
Schließlich übernimmt der moskautreue Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow die Befehlsgewalt über die Sicherheitskräfte der Region und bittet Russland um „Hilfe bei der Sicherung von Frieden und Ruhe“. Am 16. März richtet Aksjonows Regierung ein Referendum aus, dass die EU, die USA und die Übergangsregierung in Kiew als völkerrechtswidrig einstufen. Fast 96 Prozent der Teilnehmer sprechen sich darin für einen Anschluss der Krim an Russland aus. Die Wahlbeteiligung liegt nach Angaben der Wahlkommission bei 83 Prozent. Ein Verbleib der Krim in der Ukraine stand nicht zur Abstimmung. Die Beteiligten konnten zwischen dem Anschluss und der Wiederherstellung der Verfassung von 1992 entscheiden, laut der das Krimparlament über das Schicksal der Halbinsel bestimmt. Letztere Option wäre wohl ebenfalls auf den Anschluss an Russland hinausgelaufen, weil sich das prorussische Krimparlament (85 Sitze) hierfür einsetzt.
Nach dem Referendum votierte das Krimparlament einstimmig für die. Das russische Parlament (Duma) will hierfür rasch die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. „Die Menschen haben für die Wiedervereinigung mit einem Volk gestimmt, mit dem sie immer gelebt haben“, so der stellvertretende russische Parlamentschef Sergej Newerow. Die russische Regierung erklärt, den "Wunsch der Krim-Bevölkerung zu respektieren".
Laut Regional-Regierungschef Aksjonow will die Krim bereits im April den russischen Rubel als Währung einführen. Die Krim-Bewohner sollen sich entscheiden können, zwischen einem ukrainischen und dem russischen Pass. Amtssprachen sollen künftig Russisch und Krimtatarisch sein, allerdings nicht Ukrainisch. Soldaten der ukrainischen Armee sollen von der Krim abziehen. Nach vereinzelten Auseinandersetzungen zwischen dem ukrainischen und dem russischen Militär auf der Krim, haben sich Russland und die Ukraine auf eine Waffenruhe bis Freitag (21. März) geeinigt.
Auch in russisch geprägten Städten der Ostukraine fordern Demonstranten ein Referendum über den Anschluss an Russland (wie auf der Krim) abzuhalten. Pro-russische Proteste gibt es zum Beispiel in Donezk und Charkiw.
Reaktion von EU und USA
Der Westen verurteilt die russische Truppenverlagerung. US-Präsident Barack Obama sieht eine „Verletzung der ukrainischen Souveränität“. US-Außenminister John Kerry sagt, Russland würde aus freierfundenen Gründen auf der Krim einmarschieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wirft Präsident Wladimir Putin vor, mit der "unakzeptablen russischen Intervention auf der Krim gegen das Völkerrecht verstoßen zu haben“.
Obamas Sprecher Jay Carney erklärt zum Krim-Referendum: "Die internationale Gemeinschaft wird das Ergebnis einer unter Gewaltandrohung und Einschüchterung durch russisches Militär durchgeführten Befragung, die dem Völkerrecht widerspricht, nicht anerkennen." Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) kündigt an: „Auf das völkerrechtswidrige Referendum auf der Krim wird Europa eine klare und bestimmte Antwort geben.“ Zugleich warnt Steinmeier vor einer weiteren Eskalation, "die zur Spaltung Europas führen könnte".
Die EU beschloss am 17. März neue Sanktionen gegen Russland. 21 Personen erhalten Einreiseverbot in der EU, ihre Konten in der EU werden gesperrt. 13 Russen - auch Duma-Angehörige - und acht Spitzenpolitiker der Krim sind betroffen. "Das, was Russland betreibt, ist für die Europäische Union nicht hinnehmbar", so Steinmeier. Das ist ein Einschnitt, bei dem wir nicht ohne weiteres zur Tagesordnung übergehen können", so Steinmeier. Es müsse einen "Rückweg in politische Bearbeitung des Konfliktes" geben, so Steinmeier. Die USA wollen sieben Regierungsbeamten die Einreise verweigern und die Konten sperren.
Russland droht nach Informationen des SPIEGEL wegen der Krim-Krise seinen Status als G-8-Mitglied zu verlieren. Demnach planen die sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten das kommende Gipfeltreffen im April bereits ohne Russland. Es soll eigentlich im russischen Sotschi stattfinden. Die EU hatte als Reaktion auf die Ukraine-Krise bereits Anfang März Verhandlungen mit Russland gestoppt – etwa über Visa-Erleichterungen. [weniger anzeigen]
Deutschlands neue Rolle
Muss Deutschland sich stärker einmischen, um Konfliktregionen zu stabilisieren – etwa in Afrika? Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik steht neu zur Debatte. Militär-Einsätze bleiben umstritten.
Zwar würdigt Gauck Deutschlands bisherigen Weg zum „Garanten internationaler Ordnung und Sicherheit“, allerdings fragt er, ob die Bundesrepublik sich schon genug engagiert. „Tun wir, was wir tun könnten, um unsere Nachbarschaft zu stabilisieren, im Osten wie in Afrika? Tun wir, was wir tun müssten, um den Gefahren des Terrorismus zu begegnen?“
In der öffentlichen Debatte besonders umstritten sind traditionell Kampf-Einsätze der Bundeswehr. Der frühere Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hatte noch Anfang 2013 die Haltung der Bundesregierung mit den Worten zusammengefasst: „Wir stehen zur Kultur der militärischen Zurückhaltung“. Gemäß dieser Doktrin beteiligte sich Deutschland 2011 nicht am NATO-Kampfeinsatz gegen das Gaddafi-Regime in Libyen. Zumindest ausländische Medien kritisierten Berlins Zurückhaltung teils heftig. „Deutschland ist fahnenflüchtig“ titelte etwa eine französische Zeitung.
Bundespräsident Gauck wehrt sich dagegen, Militäreinsätzen aus Prinzip eine Absage zu erteilen. „Deutschland wird nie rein militärische Lösungen unterstützen, es wird politisch besonnen vorgehen und alle diplomatischen Möglichkeiten ausschöpfen“, so der Präsident. „Aber wenn schließlich der äußerste Fall diskutiert wird – der Einsatz der Bundeswehr –, dann gilt: Deutschland darf weder aus Prinzip 'nein' noch reflexhaft 'ja' sagen.“
Scharfe Kritik an Gaucks Rede kommt von der Linkspartei. „Gauck spricht nicht für alle. Das ist nicht unser Präsident“, sagte der Vorsitzende Bernd Riexinger gegenüber Handelsblatt Online. Gauck bereite einer „Militarisierung" der deutschen Außenpolitik den geistigen Boden. Diese „neue deutsche Breitbeinigkeit“ sei unerträglich. Auch Omid Nouripour, außenpolitische Fraktionssprecher der Grünen, äußerte Bedenken. „Wir haben in diesem Land auch eine historisch gewachsene Kultur militärischer Zurückhaltung“. Diese Kultur solle man nicht einfach in kürzester Zeit beiseiteschieben.
Bundesverteidungsministerin Ursula Von der Leyen (CDU) agrumentiert ähnlich wie Gauck. Mit Blick auf gewaltsame Konflikte in Syrien und Afrika sagte sie in ihrer Rede (Volltext) auf der Münchner Sicherheitskonferenz: „Die Krisen und Konflikte appellieren an unser humanitäres Gewissen, nicht diejenigen im Stich zu lassen, die am meisten leiden.“ Gleichgültigkeit sei für ein Land wie Deutschland keine Option, weder aus sicherheitspolitischer noch aus humanitärer Sicht. Offen lässt die Verteidigungsministerin, wie weit das militärische Engagement Deutschlands künftig gehen könnte, etwa in Bürgerkriegsgebieten in Afrika. „Wenn wir über die Mittel und Fähigkeiten verfügen, dann haben wir auch eine Verantwortung, uns zu engagieren“, so Leyen allgemein. Allerdings fügt sie einschränkend hinzu: „Dies bedeutet nicht, dass wir dazu tendieren sollten, unser ganzes militärisches Spektrum einzusetzen – auf keinen Fall.“
Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier plädiert für eine aktivere Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspoilitik. „Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren“, so Steinmeier in einer Rede (Volltext) auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Allerdings betont Steinmeier den klaren Vorrang nicht-militärischer Maßnahmen. „Entscheidend ist aber vor allem anderen, dass wir gemeinsam mit anderen intensiver und kreativer darüber nachdenken, wie wir den Instrumentenkasten der Diplomatie ausstatten und für kluge Initiativen nutzbar machen.“
Unionsfraktionschef Volker Kauder will von einer Debatte um mögliche Kampfeinsätze der Bundeswehr in Afrika nichts wissen. „Deutsche Kampftruppen werden in Zentralafrika nicht zum Einsatz kommen“, sagte Kauder dem „Spiegel“. „Das will niemand in der Koalition.“ Kauder zeigt sich prinzipiell skeptisch, was den Erfolg von Militär-Einsätzen angeht, auch mit Verweis auf die Lage in Afghanistan, wo die Bundeswehr seit 12 Jahren stationiert ist. „Im Laufe der Jahre sind meine Zweifel an rein militärischen Operationen (…) eher gewachsen, auch wenn sie von den Europäern getragen wurden.“ Er könne auch nicht erkennen, dass die Militäraktion Frankreichs und Großbritanniens gegen Libyen ein Erfolg war. [weniger anzeigen]
Syrien-Krise
Der andauernde Bürgerkrieg in Syrien begann im März 2011 mit einem Aufstand gegen die Regierung von Staatschef Baschar al-Assad.
Mali und die Zentralafrikanische Republik
In mehreren afrikanischen Ländern kommt es aktuell zu blutigen Konflikten. Frankreich ist mit Kampftruppen vor Ort.
Die EU will 366 Millionen Euro humanitäre Hilfe bereitstellen. Außerdem stellt sie eine Eingreiftruppe zur Stabilisierung der Zentralafrikanischen Republik. Diese soll die Hauptstadt Bangui sichern und so humanitäre Hilfen ermöglichen. Die sogenannte Eufor RCA Bangui ist die neunte europäische Militäroperation im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), und die erste seit sechs Jahren.
Allerdings ist noch unklar, welche EU-Staaten die etwa 600 Soldaten stellen. Deutschland hat signalisiert, keine Kampftruppen schicken zu wollen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen stellt jedoch den Einsatz eines Lazarett-Airbus (MedEvac) in Aussicht, um verwundete Soldaten aus Zentralafrika auszufliegen.
Paris hat bereits 1.600 Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik stationiert, um die Lage zu stabilisieren. Auch 3.600 Soldaten der Afrikanischen Union sind vor Ort.
Im westafrikanischen Mali gehen französische Soldaten seit rund einem Jahr gegen islamistische Milizen vor. Präsident François Hollande kündigte an, die Zahl der eingesetzten französischen Soldaten Anfang 2014 von etwa 2500 auf rund 1600 zu reduzieren. Zugleich könnte Deutschland die Bundeswehr-Mission in Mali ausweiten. Derzeit bilden dort 180 deutsche Soldaten die nationalen Sicherheitskräfte aus. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) kann sich eine Aufstockung der Ausbildungs-Mission auf 250 Soldaten vorstellen. „In Zentralafrika entfaltet sich ein blutiger Krieg zwischen Christen und Muslimen. Wir können nicht zulassen, dass der Konflikt die ganze Region in Flammen setzt“, so von der Leyen im Interview mit dem „Spiegel“. Niels Annen, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, rät dazu, die Debatte über das deutsche Engagement erst auf Grundlage der Ergebnisse der EU-Beratungen zu führen, und nicht über Interview-Äußerungen.
Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, sagte der "Bild am Sonntag": „Wer auch immer in Mali ernsthaft und nachhaltig Streitkräfte aufbauen will, muss sich auf eine Einsatzdauer von mindestens zehn Jahren einstellen, so katastrophal ist der Zustand der Armee dort.“
Auch in der Demokratischen Republik Kongo, dem Südsudan und dem Tschad ist die Sicherheitslage – teilweise seit Jahrzehnten - instabil. [weniger anzeigen]
Cyber-Sicherheit und Internet-Überwachung
Seit Jahren warnen Sicherheitspolitiker vor terroristischen Cyber-Attacken, etwa auf kritische Infrastrukturen wie Handelsbörsen und Kraftwerke.
Größere terroristische Cyber-Angriffe sind bislang nicht bekannt geworden. Der hohe britische Sicherheitsbeamte Stephen Cummings hält die Debatte für übertrieben. "Cyberterrorismus ist ein Mythos“, so Cummings 2008.
Allerdings stehen Staaten im Verdacht, Cyberangriffe durchzuführen, etwa um an militärische Geheimnisse zu kommen. So werfen sich die USA und China regelmäßig gegenseitig vor, Cyber-Spionage zu betrieben. Inzwischen haben die beiden Länder eine gemeinsame Cyber-Arbeitsgruppe vereinbart. Die USA wollten stärker mit China und anderen Partnern zusammenarbeiten, um internationale Normen eines verantwortungsvollen Verhaltens im Cyberspace zu etablieren, erklärte der amtierende Verteidigungsminister Chuck Hagel.
Verbindliche internationale Abkommen gegen die Cyberspionage kommen allerdings nicht voran. Daran änderte bislang auch der NSA-Skandal nichts. Anfang 2013 wurde bekannt, dass westliche Geheimdienste wie die National Security Agency die weltweite Internet-Kommunikation im großen Stil überwachen. Weder Deutschland und die USA noch die europäischen Partner konnten sich seitdem auf sogenannte No-Spy-Abkommen einigen, die etwa das gegenseitige Ausspähen von Regierungsmitgliedern und Unternehmen verbieten.
Ende 2013 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution zum "Recht auf Privatheit im digitalen Zeitalter". Initiatoren waren Deutschland und Brasilien. Die Resolution ist rechtlich nicht bindend. Bürgerrechtlern wie Amnesty International und Electronic Frontier Foundation (EFF) geht sie nicht weit genug. [weniger anzeigen]
Europäische Armee
Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die alte Frage nach einer europäischen Armee neu in die Debatte gebracht.
Auch der grüne EU-Politiker Daniel Cohn-Bendit setzt sich für die Idee ein: „In den nächsten 20 Jahren braucht es eine europäische Armee“, so Cohn-Bendit. Als Argument führt er die Militärausgaben an. „Wir geben 130 Milliarden Euro umsonst aus, weil die EU-Staaten immer das Doppelte und Dreifache anschaffen.“
Unterstützung kommt auch von Rainer Wieland, Präsident der Europa-Union. „Bis 2030 werden wir eine europäische Armee haben“, so Wieland. „Gemeinsam werden wir Europäer (…) über eine größere Einsatz- und Verteidigungsbereitschaft verfügen als das gegenwärtig bei viel höheren Militärausgaben der Fall ist.“
Bislang hat die EU im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik/GSVP eine Reihe von Institutionen geschaffen, etwa einen gemeinsamen Militärausschuss (EUMC). Auch bestritten EU-Staaten im Rahmen der GSVP bereits einige gemeinsame EUFOR-Missionen, etwa im Kongo und in Bosnien-Herzegowina. Außerdem steht eine 1.500 Soldaten starke EU-Kampfgruppe (EUBG) für Missionen in Krisenregionen bereit, für die es ein UN-Mandat gibt.
Allerdings agieren die EU-Staaten in vielen Konflikten weiterhin national. So beteiligte sich beispielsweise Deutschland 2011 nicht am internationalen Militäreinsatz in Libyen, an dem Frankreich und Großbritannien mitwirkten. Die Diskussion einer Europaarmee reicht bis in die 1950er Jahre zurück. [weniger anzeigen]
Was ist die Münchner Sicherheitskonferenz?
Seit fünf Jahrzehnten treffen sich in München regelmäßig Sicherheitspolitiker, Militärs und Unternehmer. Sie diskutieren aktuelle sicherheitspolitische Fragen. Verbindliche Entscheidungen treffen sie nicht.
Seit 2009 leitet der ehemalige Diplomat Wolfgang Ischinger das jährliche Treffen zu aktuellen sicherheitspolitischen Fragen. Geladen sind regelmäßig Gäste aus der EU und den USA, aber auch aus Ländern wie Russland, China und Indien.
2014 waren unter anderem UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon, NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, und der ukrainische Oppositionsführer Vitali Klitschko anwesend. Eröffnet wurde das Treffen 2014 von Bundespräsident Joachim Gauck. Auch die Bundesminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), Ursula von der Leyen (CDU), Sigmar Gabriel (SPD) und Thomas de Maizière (CDU) nahmen teil.
Auf dem Programm standen 2014 unter anderem: die Syrien-Krise, die Verhandlungen zum iranischen Nuklearprogramm, die transatlantischen Beziehungen, die Zukunft der europäischen Verteidigungspolitik sowie Freiheit und Sicherheit im digitalen Raum.
Sponsoren der Konferenz waren 2014 große Unternehmen wie Microsoft, Shell und BMW, aber auch Firmen, die zumindest teilweise im Rüstungsbereich tätig sind, darunter Airbus und IABG. Der deutsche Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann wurde neben der Deutschen Telekom und der Barclays-Bank als Associate („Partner“) geführt.
Kriegsgegner riefen auch 2014 zu Protesten auf. Sie sehen in der Konferenz ein „medienwirksames Propagandaforum für die völkerrechtswidrigen Angriffskriege der NATO-Staaten“. Claus Schreer, Mitorganisator der Gegenaktionen, wirft Konferenzleiter Ischinger vor, ein „Kriegstrommler“ zu sein. Ischinger wehrt sich gegen die Kritik: „Das ist kein Kriegstreiber-Treffen, keine Nato-Tagung, das ist nicht die Jahreshauptversammlung der Rüstungslobby.“ [weniger anzeigen]
Nächste Termine
- Keine Einträge.