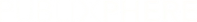Foto: Ryan McGuire (CC0 1.0 Universal)
Foto: Ryan McGuire (CC0 1.0 Universal)
Zur Generation Y gehören und einer Partei beitreten? Passt das zusammen? Alisa hat den Schritt getan. Was sie an ihrer Partei nervt und warum sie trotzdem bleibt, schildert sie hier...
Ein Beitrag von Alisa
Ich erinnere mich noch gut an meine erste Jahreshauptversammlung im Ortsverein, im deutschen Wirtshaus zwischen Hirschgeweihen und Wiener Schnitzel. Als Gerade-so-Abiturientin war ich zweifellos eine Exotin inmitten ‘alter weißer Männer’. TOP 3 auf der Tagesordnung: Wahlen. Als der Vorsitzende, einziger Kandidat für die Wiederwahl, im dritten Wahlgang immer noch nicht die nötige Mehrheit hatte, und eine wutentbrannte Diskussion zwischen den alten Herren um seine Eignung bzw. das weitere Wahlverfahren laut Geschäftsordnung entbrannte, war ich mir ziemlich sicher: ich würde nicht wiederkommen.
Warum sind wir hier?
Die innerparteilichen Rangeleien und die vielen Verfahrensregeln sind symptomatisch für Parteien. Sie sind Räume, in denen die Zeit in vielen Dingen stehen geblieben zu sein scheint. Es verwundert kaum, dass sie oft alle Klischees einer behäbigen, verkrusteten Organisationsform in sich vereinen:
Sie sind, empirisch betrachtet, sozial hoch selektiv: ein Sammelpunkt für Menschen mit dominanter Persönlichkeit.
Die hoch formalisierten Entscheidungsprozesse verschleppen Entscheidungen und Initiativen oft lange.
Und für Nichtmitglieder ist die Arbeit von Parteien häufig ebenso undurchschaubar wie exklusiv: Die Dialektik des „Wir gegen die” (wobei der Feind fast immer im anderen politischen Lager zu finden ist und selten in der sinkenden Wahlbeteiligung oder im Mangel an neuen Mitgliedern) manifestiert sich in ideologischen Debatten und Gruppendenken.
Das alles ist ermüdend.
Und was ist eigentlich mit den “großen" Fragen? Sind es tatsächlich unsere Überzeugungen, wegen denen wir hier sind? Der Wunsch, die Welt etwas besser zu machen? Oder geht es doch auch darum, sich schlichtweg wichtig zu machen?
Muss ich sogar aufpassen, in diesem Milieu nicht selbst zur „Parteisoldatin“ oder zum „Apparatschik“ transformiert zu werden?
Viele meiner GenerationsgenossInnen verwirklichen sich politisch – wenn überhaupt – in jungen, dynamischen, zivilgesellschaftlichen Initiativen, statt in den großen alten “(Volks-)parteien”. Sie sehen sich lieber als “neues politisches Spektrum jenseits von links und rechts” und wollen auf flache Hierarchien nicht mehr verzichten. Oder sie sind noch “schwer damit beschäftigt, diese Welt zu verstehen” und müssen noch nachdenken, bevor sie sich an politische Lösungen wagen können.
Also weshalb bin ich immer noch hier, in meiner Partei?
Im Laufe der Zeit hatte ich auch viele schöne bereichernde und motivierende Parteierlebnisse und Begegnungen mit ParteigenossInnen. Letztendlich ausschlaggebend war jedoch besonders ein Punkt: die Erkenntnis, dass in unserer Demokratie noch immer der Grundsatz gilt: „Parties matter.“ In der Partei sind wir alle irgendwie PolitikerInnen – mit der echten Möglichkeit, etwas zu verändern.
In dem Moment, in dem es mir darum geht, Politik nicht nur zu verstehen und zu diskutieren, sondern auch zu gestalten, bieten andere politische Organisationen, Plattformen und Bewegungen für mich keine wirkliche Alternative zur Partei. In der Partei diskutieren und verabschieden wir Programme, ziehen mit unseren Ideen in den Wahlkampf, und kämpfen um die Stimmen, sie umzusetzen. In jedem Schritt habe ich die Möglichkeit, mit meiner Initiative, meiner Kreativität diesen Prozess auf kleiner Ebene zu gestalten. Das ist echte Politik. Echter geht es nicht.
Es ist einfach so: Parteien sind der effizienteste und vielleicht einzige Weg, direkt, in einem längeren Zeithorizont und mit konkret messbarem Umfang Dinge zu bewegen.
Wo kommen wir schneller mit der Stadtverwaltung ins Gespräch, um uns gegen zu strikte Einschränkungen der Straßenmusik zu wehren? Wo sonst könnte ich über die Annahme eines Koalitionsvertrags abstimmen, für dessen Inhalte ich mitgekämpft habe? Wo sonst kann ich MitstreiterInnen für meine neue Idee finden, damit sie Eingang ins Wahlprogramm für die nächste Landtagswahl findet?
An meinen Bundestagsabgeordneten muss ich nicht unbedingt eine Petition schicken – ich frage ihn bei der nächsten Parteiveranstaltung einfach persönlich. Oder ich bringe das Thema bei unserem nächsten Ortsvereinstreffen auf die Tagesordnung. Und die verhassten und umkämpften innerparteilichen Wahlen ermöglichen es mir eben auch, über meine persönlichen Initiativen hinaus den Kurs meiner Partei mitzubestimmen.
Wir können nicht ewig nachdenken
Die Beziehung zu meiner Partei ist nach wie vor sehr ambivalent. Im Dilemma zwischen dem Wunsch, sich von alten Strukturen zu befreien und dem Wunsch, mit gebündelter Kraft Dinge zu bewegen, hat mich das Argument der sich eröffnenden Handlungsmöglichkeiten letztlich überzeugt. Natürlich stecken Parteien voller Dysfunktionen. Manchmal wünsche ich mir auch einen freieren Raum, in dem es offener, schneller, fairer zugeht.
Zugleich fühle ich die Mission – oder ist es eine fixe Idee? – diese Partei als existierenden, bereits organisierten und vernetzten Raum nach meinen Vorstellungen mit- und neu zu gestalten: mit meinem Wissen, meinen Erfahrungen und Talenten, mit meiner Leidenschaft. Das empfinde ich als konstruktiver, als nur besserwisserisch daneben zu stehen und zu bemerken, dass die Parteiendemokratie ja wohl ganz gewaltig am Kränkeln ist.
Auch als “Generation Y” können wir nicht ewig über alles nachdenken und abwarten. Wenn wir nicht mitentscheiden, dann entscheiden das einfach andere für uns.
Vor Kurzem war ich übrigens auf meiner vierten Jahreshauptversammlung im Ortsverein. Geradezu in gegenseitiger Hassliebe sind die Partei und ich einander treu geblieben.
P.S: Falls ihr Fragen zum Parteileben habt, können wir sie gern hier diskutieren...
Weitere Texte zur Generationen- und Parteien-Debatte
Julian Leitloff: Generation Y: Eine Abrechnung
Linn Selle: Generation Europa: Wir sind anders...und wir sind viele
Aidin Halimi Asl: Beleidige nicht meine Generation
Fwd: Europe: POLITISCHE Bildung für die europäische Demokratie